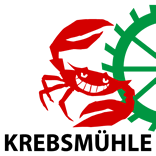1975, just in dem Jahr, in dem die Krebsmühle in ihren Dornröschen-Schlaf fiel, wurde es im benachbarten Frankfurter Stadtteil Heddernheim sehr lebendig. Dort hatte sich in einem versteckt direkt am Bahndamm gelegenen Gehöft eine Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammengefunden, die die derzeit von den Frankfurter ‚Spontis‘ um Dany Cohn-Bendit und Joschka Fischer ausgerufene politische ‚Stadtteilarbeit‘ sehr praktisch umsetzen wollte und sich mit einem speziellen sozialarbeiterischen Ansatz um rebellische (arbeitslose) Jugendliche kümmerte.
Das Kind brauchte einen Namen und nannte sich ‚Arbeitslosenselbsthilfe‘ oder kurz ASH.
Dieser Ansatz ging zwar schief und endete bereits nach einem guten halben Jahr. Mittlerweile aber hatten die Beteiligten ‚Blut geleckt‘ und beschlossen, einen eigenen Betrieb zu gründen, als Alternative zu dem vorgegebenen – als sinnentleert empfundenen – Leben und arbeiten in der kapitalistischen Umwelt.
Über diese ersten Entwicklungen bis hin zur Übernahme der Krebsmühle soll hier kurz berichtet werden:
1. Gründung als Arbeitslosenselbsthilfe
Die ASH entstand 1975 aus einer Wohngemeinschaft heraus, die sich politisch der Frankfurter “Sponti-Szene” um Dany Cohn-Bendit und Joschka Fischer verbunden fühlte. Dort war man zu dieser Zeit bemüht, das Ghetto der engen studentischen (oder jugendlichen) Szene zu durchbrechen und mehr Kontakt zur Normalbevölkerung herzustellen. Zu diesem Zweck entstanden “Stadtteilzentren”, eines davon in Frankfurt-Heddernheim. Unsere WG war dort engagiert und auch beteiligt bei der Übernahme des “Elfmeter”, einer eingesessenen Kneipe im Stadtteil.
Kontakt mit der Normalbevölkerung gab es dort reichlich, meist in Form von Konflikten mit ansässigen Problemjugendlichen. Um mit diesen arbeitslosen und kriminalisierten Jugendlichen zurechtzukommen, gründeten wir die Arbeitslosenselbsthilfe. Der Ansatz war sozialarbeiterisch und gedacht als Hilfe zur Selbsthilfe (sic!): Für die Jugendlichen Arbeit zu beschaffen, sie zusätzlich in die gesamte “Betriebs”organisation einzubinden (und damit die Entfremdung der Arbeit aufzuheben) und sie auf diese Weise zu integrieren. Dieser Ansatz ging fürchterlich daneben und hat sich nach einem halben Jahr erledigt.
2. „Nie mehr Sozialarbeit“
Der Streß im Umgang mit den Jugendlichen hatte zusammengeschweißt. Mehrere Mitglieder der ursprünglichen WG waren abgesprungen, andere im Zuge der Arbeit neu hinzugekommen. Es entwickelte sich ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Da jetzt alle die gleichen Voraussetzungen hatten – nämlich arbeitslos zu sein und das Studium entweder garnicht erst begonnen oder abgebrochen zu haben – wurden die jetzt folgenden Diskussionen und die weitere Entwicklung der Gruppe tatsächlich auch von allen getragen.
Die WG wurde zur Großfamilie, zur Kommune.
Anstehende Aufgaben wurden gemeinschaftlich gelöst bzw. in entsprechenden Diskussionen verteilt, es gab eine gemeinsame Haushaltskasse, in die alle Einnahmen gingen und von der sich alle nach Bedürfnis bedienten. Wir verdienten das Geld mit einfachen Arbeiten, nämlich Entrümpelungen, Haushaltsauflösungen und Transporten, zu deren Durchführung wir uns einen alten LKW neu aufgebaut hatten.
Wir waren “ausgestiegen”, machten unser eigenes Ding und – durchaus im Trend der damaligen Zeit – “Politik in erster Person”, d.h. beschäftigten uns mit uns selbst und den gruppendynamischen Prozessen. Natürlich besuchten wir nach wie vor das Stadtteilzentrum und den “Elfmeter”, man fand uns auf Demos oder “Teach-Ins”, aber das waren mehr oder weniger gesellschaftliche Ereignisse, die man eben wahrnahm. Was anders war: Wir taten das jetzt nicht mehr als Individuen, sondern als Gruppe. Als Gruppe traten wir auf, wurden wir wahrgenommen und – je nachdem – angefeindet oder bewundert. Das verstärkte den Prozess der Gemeinschaftsbildung und schuf den “harten Kern” einander vertrauender Mitglieder, der in den folgenden Jahren das ASH-Schiff durch viele Stürme führen konnte. Es war eine Übergangszeit, die damit endete, dass uns seitens unseres Vermieters die gewerblichen Tätigkeiten auf unserem Wohngelände verboten wurden.
3. Bonames – Die ASH als Alternativbetrieb
Wir fanden Räume in einer alten Schuhfabrik in Bonames, einem Stadtteil im Frankfurter Norden. Hier konnten wir große Flächen zum Billigstpreis anmieten und später weitere auch ohne Mietvertrag in Besitz nehmen. Dies störte niemanden, weil das Gelände zum Abriß bestimmt war und nur noch “Restzusatzverwertung” stattfand. Ein Paradies für uns, denn wir konnten darin machen, was immer wir wollten.
Na ja – Paradies!
Was von einem Fabrikstockwerk ohne Heizung, mit einfach verglasten Metallgitterfenstern zu halten ist erlebten wir schnell im nächsten Winter. Bis dahin hatten wir, um der durch das schnelle Wachstum der Gruppe entstandenen drückenden Enge unserer WG zu entkommen, im neuen Domizil Wände eingezogen und einzelne Zimmer sowie einen Gemeinschaftsraum mit Küche geschaffen. Jetzt wurden auf die Schnelle Kohleöfen beigeschafft (keine Schwierigkeit: davon fanden wir genug beim Entrümpeln), mit Rauchabzügen direkt aus dem Fenster heraus. Es blieb bitterkalt und die Wintermonate waren hart.
Aber auch solche Widrigkeiten schweißen zusammen. Und unser Lebensgefühl war positiv: Wir fühlten uns frei. Unsere Arbeit bestand nach wie vor im Entrümpeln und dem Verkauf noch brauchbarer Gegenstände in unserem “Flohmarkt”. Später sind wir dazu übergegangen, auch gezielt Polstergarnituren und andere gebrauchte Möbel anzukaufen. Außerdem übernahmen wir Transporte und Umzüge. Die Geschäfte liefen nicht bombig, aber es reichte zum Leben.
Die anfallenden Arbeiten (Transportarbeiten, Arbeiten im “Flohmarkt”, Bürodienst, Gemeinschaftsdienst mit Kochen) wurden im „Rotationsprinzip“ erledigt. “Bei uns gibts keinen Chef” und “Jeder macht jede Arbeit” waren unser Motto. Der Gemeinschaftsdienst hatte abends für alle gekocht, das gemeinsame Essen diente der Kommunikation und der Einteilung der Arbeit für den nächsten Tag.
Wir waren ein klassischer “Alternativbetrieb”, gleichzeitig eine Lebensgemeinschaft, ziemlich bedürfnislos, denn wir hatten eigentlich immer was zu tun und weder Zeit noch Lust zum Konsumieren.
4. Euphorie und Politik
Mitte der 70er Jahre entstanden überall alternative Ansätze. Es war die Zeit der ‚Sinnkrise‘ – viele Menschen, nicht nur Jugendliche, empfanden das Arbeiten und Leben in der kapitalistischen Umwelt als sinnentleert und suchten nach Alternativen. Es schien, als würde das System an sich selbst, an den eigenen Widersprüchen zugrunde gehen. Nur noch eine Frage der Zeit?
Wir fühlten uns ‚mittendrin‘, als eine Speerspitze der Gegenbewegung. Wir waren euphorisch und ausgestattet mit viel (für manche zu viel) Sendungsbewußtsein.
Die tägliche Arbeit wurde zwar ernstgenommen, weil notwendig für das Überleben – mindestens gleichwertig war aber die Politik, der Versuch, aus den vielfältig vorgefundenen Ansätzen eine ‚Bewegung‘ zu machen. Über einen von uns organisierten Selbsthilfe’kongress‘ wollten wir verschiedene Gruppen und Projekte zusammenbringen, organisierten von dort an regelmäßige ‚Delegiertentreffen‘, beteiligten uns an ‚Newslettern‘ und gründeten unsere erste Zeitung (Titel: ‚Wir wollen´s anders‘).
Nachdem wir feststellen mussten, dass die Vorstellungen der ‚Alternativ’projekte allzu heterogen waren, um daraus eine politische Linie zu formen, verabschiedeten wir uns von der Alternativbewegung und stürzten uns – ausgehend von unserer eigenen Praxis – in den Versuch, eine Bewegung selbstverwalteter Betriebe zu initiieren.
5. Auf Standortsuche
Mehr und mehr beschäftigte uns der Gedanke, wie wir unsere Art zu leben und zu arbeiten – uns selbst – zum Modell für eine andere Gesellschaft machen könnten. Dies am vorhandenen Standort mit all seinen Unzulänglichkeiten und der kurz bemessenen Perspektive zu realisieren erwies sich jedoch als unmöglich. Wir waren nur Mieter (unter anderen) und schon von daher eingeschränkt in dem, was wir auf dem Gelände der Schuhfabrik dazu hätten umgestalten wollen und müssen. Unser ‚Mietvertrag‘ sah keine Schutzrechte vor. Es war im Gegenteil klar, dass die Gebäude in absehbarer Zeit abgerissen werden und wir unser Domizil verlieren würden.
Das hätte das Ende der Gruppe und aller bereits entwickelten Vorstellungen bedeutet.
Deshalb suchten wir fast ein Jahr lang intensiv nach einem neuen, dauerhaften Zuhause und das Ergebnis war schließlich – nach etlichen Irrläufern – die Krebsmühle.
Die wesentlichen Prinzipien der ASH zum Zeitpunkt der Krebsmühle-Übernahme
Profit i gitt!
Alles, was mit Mehrwert, Ertrag und Rendite zu tun hat, ist für uns Feindesland, ist Kapitalismus, Teil des Systems, das zu ersetzen, auszuhebeln, mindestens aber zum Menschlichen hin zu verändern wir angetreten sind. Kein Gedanke an Profit!
Kostendeckungsprinzip statt Profit.
Gegen die Orientierung am Profit der kapitalistischen Wirtschaft stellen wir das Kostendeckungsprinzip: Das ökonomische Ziel ist erreicht, wenn genug erwirtschaftet wird, um die anfallenden Kosten zu decken.
Nicht auf Fördertöpfe schielen!
Wer von Spenden, Zuschüssen und Fördertöpfen lebt, kann nicht gleichzeitig beanspruchen, Modell für eine veränderte Gesellschaft zu sein. Für das nötige Einkommen für Essen, Mieten, Kreditraten usw. müssen wir also mit unseren Betrieben und unserer Arbeit selbst sorgen. Auf diese Unabhängigkeit legen wir großen Wert.
Nicht Mitarbeiter, sondern Gruppenmitglied.
Wir suchen nicht nach „Personal“, sondern nehmen neue Mitglieder in die Gruppe auf, die mitmachen wollen beim selbstverwalteten Projekt. Danach müssen wir eben Arbeit für diese Neuen finden und gegebenenfalls dafür neue Arbeitsbereiche aufbauen.
Nicht Lohn, sondern Gemeinschaftskasse.
Alle Einnahmen wandern in die Gemeinschaftskasse, aus der sich jeder nach Bedürfnis (in Krisenzeiten eher nach Bedarf) bedienen kann. Individuellen Lohn gibt es nicht.
Keine Trennung von Kopf- und Handarbeit.
Verwaltungsaufgaben sind notwendige Arbeiten. Sie sind aber den anderen Arbeitsbereichen gleichgestellt und werden wie diese im Rotationsprinzip von allen gleichermaßen durchgeführt.
Jede/r macht jede Arbeit.
In einer gemeinsamen Arbeitsbesprechung (in der Regel nach dem Abendessen) werden die für den nächsten Tag anstehenden Arbeiten aufgeteilt. Die Gruppenmitglieder ordnen sich selbst nach dem Prinzip der Freiwilligkeit den Aufgaben zu. Dabei soll möglichst ‚rotiert‘, also zwischen den verschiedenen Arbeiten gewechselt werden. Es wird so lange diskutiert, bis alle anstehenden Aufgaben personell abgedeckt sind. Frauen und Männer sind gleichberechtigt.
Es gibt keinen Chef.
Alle Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Es gilt das Konsensprinzip, d.h. bei strittigen Fragen muss so lange diskutiert werden, bis eine Übereinkunft hergestellt ist.
Kein Privateigentum an Produktionsmitteln.
Wer in die Gruppe ‚einsteigt‘ muss kein ‚Eintrittsgeld‘ (Anteil am erarbeiteten finanziellen Wert) zahlen. Er nimmt am Arbeitsleben teil und verfügt gemeinsam mit allen über die Mittel (z.B. den Fuhrpark) und Werte (den Warenbestand) der Gruppe. Wer die Gruppe verlässt, hat umgekehrt keinen Anspruch auf Entschädigung.